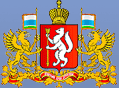Deutsch-russisches Projekt / Interethnische Beziehungen, Migration und Integration / INTEGRATIONSPOLITIK Integration durch Partizipation
Kommunale Strategien zur gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten
1. Integration und Kommunale Verantwortung
Im Folgenden soll am Beispiel der Landeshauptstadt München aufgezeigt werden, wie kommunale Politik und Verwaltung ihrer Verantwortung für die Integration von Minderheiten in die Stadtgesellschaft gerecht werden können. Die Kommunen als Kristallisationsorte zivilgesellschaftlichen Zusammenlebens, alltäglicher Daseinsvor-sorge und unmittelbarer Politikerfahrung bieten für eine Integration durch Partizipation besondere Chancen. Unter Integration verstehen wir einen längerfristigen Pro-zess der Eingliederung von Zuwanderinnen und Zuwanderern mit dem Ziel, zu einer Angleichung ihrer Lebenslagen zu kommen. Für das Gelingen dieses Prozesses tra-gen Zugewanderte wie Mitglieder der Aufnahmegesellschaft in gleicher Weise Ver-antwortung. Unser Integrationsverständnis respektiert und wertschätzt kulturelle Vielfalt.
In diesem Definitionsversuch sind schon die verschiedenen Dimensionen angedeutet, in denen sich gesellschaftliche Integration vollzieht. Mit Friedrich Heckmann (2003) unterscheiden wir vier Dimensionen:
Strukturelle Integration
Diese beinhaltet den Erwerb von Rechten und den Zugang zu Positionen in den Kerninstitutionen der Aufnahmegesellschaft wie beispielsweise Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Bildungssystem, Gesundheitssystem oder politische Interes-senvertretungen.
Kulturelle Integration
Sie meint eine Annäherung zwischen Zugewanderten und der aufnehmenden Gesellschaft, die mit einer Veränderung von Einstellungen und Verhalten durch Austauschprozesse einhergeht.
Soziale Integration
Sie beschreibt den Erwerb gesellschaftlicher Mitgliedschaften in der privaten Sphäre wie Vereinen oder Freundeskreisen.
Identifikatorische Integration
Diese umfasst ein Zugehörigkeitsgefühl und die Bereitschaft, sich mit Strukturen der Aufnahmegesellschaft wie Stadt oder Stadtteil zu identifizieren.
Vor diesem Hintergrund kommt der kommunalen Verwaltung besondere Bedeutung zu. Verwaltung verändert sich: Das Bild der hoheitlichen Eingriffsverwaltung, in Kategorien des Über- und Unterordnungsverhältnisses denkend und handelnd, wandelt sich zum Leitbild der Dienstleistungsorganisation mit planenden, steuernden, prob-lemlösenden, helfenden, ermächtigenden und beteiligungsorientierten Elementen. Dieser Vision fühlt sich insbesondere die Sozialverwaltung verpflichtet. Bürgerinnen und Bürger sollen „wie“ Kundinnen und Kunden behandelt werden. Eine stärkere Subjektorientierung verbunden mit einer aktiven Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer löst die alte Objektstellung ab. Soziale Dienste etwa versuchen, die Defizite ihrer Klientel nicht mehr in den Vordergrund zu stellen, sondern ressourcenorientiert zu arbeiten. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf wirklich alle Einwohnerinnen und Einwohner, also auch die Minderheitenangehörigen.
Die überwiegende Mehrzahl der öffentlichen Dienstleistungen, die gesamte alltägliche Daseinsvorsorge, wird von kommunalen Diensten (einschließlich der freien Träger) erbracht. Die interkulturelle Orientierung und Öffnung der Regelversorgung für Minderheiten, speziell für Migrantinnen und Migranten ist damit eine Frage sozialer Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Interkulturelle Sensibilität wird zu einer Heraus-forderung für eine professionelle, also gute Praxis.
Als Vision für eine Gestaltung der sozialen Stadt lassen sich die folgenden Leitlinien formulieren:
• Unterschiede anerkennen
• Vielfalt gestalten
• Integration gewährleisten
• Solidarisches Handeln anregen und fördern
• Selbsthilfe und Eigeninitiative stärken
2. Partizipation und Empowerment
Soziale Kommunalpolitik kann nur als integrierter Politikansatz, der Teilhabe und Teilnahme der Stadtbevölkerung fördert und fordert, erfolgreich sein. „Partizipation und Empowerment“ können deshalb als eine kommunalpolitische Grundphilosophie für eine zivilgesellschaftliche Orientierung verstanden werden: Partizipation als Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern der sozialen Dienstleistungen sowie Empowerment als Befähigung und Ermächtigung zur Selbstsorge sind Einstellungen, die an den Stärken und Fähigkeiten der Menschen ansetzen und diese darin unterstützen, „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu entwickeln.
Dies bedeutet gerade im Bereich der Sozialen Arbeit, sich von einer Defizit- zu einer Ressourcenorientierung hin zu bewegen. Es gilt also, vorhandene Fähigkeiten auf-zuspüren, an ihnen anzusetzen und sie zu stärken. Wenn man sich das herkömmliche Bild von Migrantinnen und Migranten vor Augen führt, dann wird deutlich, dass hier wirklich ein Perspektivenwechsel erforderlich ist. Migrantenfamilien und ihre Kin-der werden vornehmlich als defizitäre Wesen gesehen, denen Hilfe zu gewähren ist. Damit werden ihnen aber Chancen für ein gemeinschaftliches Handeln, für die Übernahme von Verantwortung, für Selbstorganisation und Selbstsorge genommen. Es geht darum, auch Migrantinnen und Migranten als Menschen anzuerkennen, die ihr Leben aktiv gestalten, die zur Selbstentscheidung und Selbstdefinition fähig sind und befähigt werden können. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass hier ein sehr weites Verständnis von Beteiligung vertreten wird.
3. Integrationspolitik als kommunalpolitische Querschnitts- und Gesamtsteue-rungsaufgabe
Kompetentes Handeln in kulturell differenzierten Einwanderungsgesellschaften setzt soziale und interkulturelle Handlungskompetenz voraus. Interkulturelle Orientierung nimmt subkulturelle Minderheiten als Folge von Migrations- und Pluralisierungspro-zessen in den Blick und richtet ihr Augenmerk auf Exklusionsmechanismen der Stadtgesellschaft bzw. ihrer jeweiligen Teilsysteme. Ein solches interkulturelles Ver-ständnis verhindert die Gefahr der Kulturalisierung und Ethnisierung sozialer Sach-verhalte durch das Reflexiv werden der eigenen Sichtweisen. Das Verhältnis zwischen Mehrheits- und Minderheitenkultur ist immer auch als ein Machtverhältnis zu reflektieren.
Vor dem Hintergrund einer solchen reflexiven Interkulturalität (Hamburger 1999: 38) sind es insbesondere drei Ebenen, die das Verhältnis von Verwaltung zu Minderheiten bestimmen.
3. 1 Normative Ebene
Kommunalpolitik muss sich der Frage stellen, ob sie überhaupt einem und welchem interkulturellem Paradigma sie sich verpflichtet fühlt. Dabei geht es um Stadtentwick-lungsplanung im weitesten Sinne, also um die Frage, wie Kommunalpolitik und ihre jeweiligen Fachpolitiken mit Minderheiten und hier insbesondere mit eingewanderten Minderheiten umgehen. Eine solche zukunftsorientierte Vorstellung muss von einem Welt-Bild ausgehen, dass von Diversität und Differenz geprägt sein wird. Eine we-sentliche Leitvision wäre dann beispielsweise die Stärkung der Integrationskräfte ei-ner urbanen Gesellschaft.
Für die Kommune bedeutet ein solcher Politikansatz eine Abkehr von einer reaktiven zu einer gestaltenden Sozialpolitik sowie einen Paradigmenwechsel von kommunaler Sozialpolitik hin zu einer sozialen Kommunalpolitik, die Stadt insgesamt als zu ges-taltenden sozialen Raum begreift. Das beinhaltet, der Komplexität sozialer Politik und Herausforderung mit integrierten Handlungsansätzen der wesentlichen Politikbereiche wie Stadtentwicklung, Wirtschaft, Gesundheit, Bildung oder Soziales zu begegnen.
Eine solche Politik muss von der Einsicht ausgehen, dass ethnisch-kulturelle Hetero-genität heute Normalität ist. Eine zukunftsweisende Perspektive wäre es, diese Hete-rogenität als produktive Ressource und nicht vorwiegend unter dem Aspekt der kommunalen Belastung zu sehen. Das heißt nicht, strukturell problematische Situati-onen in den Stadtquartieren zu missachten, im Gegenteil: Infrastrukturelle Defizite sind Ansatzpunkte für kommunalpolitische Interventionsansätze mit dem Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Sozialräumen zu schaffen. Eine solche Inklusionspolitik nimmt also strukturelle Probleme in den Blick. Die räumliche Konzentration einer Ethnie oder nationalen Gruppe allein kann kein Indikator sein für kommunale Eingriffe. Werden aber aus strukturellen Gründen Strategien zur Verhinderung von räumlicher Segregation entwickelt, sind die nachbarschaftlichen Netzwerke von Minderheiten zu berücksichtigen, um nicht deren Ressourcen zu schwächen.
Es ist somit Zurückhaltung bei Interventionen im lebensweltlichen Bereich gefordert und eine kultursensible Unterstützung von Integrationsprozessen. Es besteht noch zu wenig Sensibilität bei der planenden Verwaltung gegenüber ethnisch-kulturellen Minderheiten und deren Berücksichtigung bei der Planung beispielsweise im Zusammenhang mit unterschiedlichen Raumaneignungsverhalten. So wäre bei der Grünplanung auf das Freizeitverhalten von nichtdeutschen Familien zu achten, die häufig in sehr unterschiedlicher Weise Flächen nutzen. Ebenso wäre zu berücksichtigen, dass die Raumnutzung nichtdeutscher Jugendlicher auf öffentliche Flächen verwiesen ist, weil sie ihre Sport- und Freizeitbedürfnisse weniger in organisierten Vereinsstrukturen als deutsche Jugendliche befriedigen. Beteiligungs- und Artikulationsmöglichkeiten für Minderheiten sind noch gemeinsam zu finden: Einwanderer müssen vom Objekt sozialer Versorgungsplanung zum Subjekt beteiligungsorientierter Stadtplanung werden.
Das gilt beispielsweise für das interessante Feld der gemeinwesenorientierten ethni-schen Ökonomie, das in der kommunalen Wirtschaftsplanung noch kaum eine Rolle spielt. Dabei ist dieser Sektor nicht nur bedeutsam für die Versorgung eingewander-ter Minderheiten oder für die Bereicherung deutscher Konsumgewohnheiten. Er ist zunehmend ein Wirtschaftsfaktor, der Ausbildungs- und Arbeitsplätze schafft und für die sozioökonomische Inklusion jugendlicher Migranten, durchaus auch unter dem Aspekt einer sozialen Kontrolle durch die Einwanderungskolonien, eine wirksame Rolle zu spielen beginnt. Diese Form von lokaler Ökonomie bedeutet zugleich eine Aufwertung des Quartiers, eine Brückenfunktion zwischen Einheimischen und Zuge-wanderten sowie eine Qualifizierung der Nahversorgung.
Die hier skizzierten normativen Grundüberlegungen müssten sich in einem differen-zierten kommunalpolitischen Integrationskonzept bündeln.
3.2 Institutionelle Ebene
Die für Verwaltung neue und noch zu erwerbende Kompetenz heißt Steuerung. Hier-bei geht es um den wirtschaftlichen und wirksamen Einsatz knapper werdender Res-sourcen zum Erreichen vereinbarter Ziele und gewollter Wirkungen. Die kommunale Verwaltung muss ihre Steuerungsverantwortung mit dem Ziel wahrnehmen, über Steuerungsprozesse kommunalpolitische Handlungsfelder interkulturell zu öffnen und integrationspolitische Wirkungen zu erzielen. Der Münchner Ansatz einer inter-kulturelle Orientierung und Öffnung der Verwaltung verdankt sich der Überlegung, sich in den aktuellen Verwaltungsmodernisierungsprozessen einzuklinken und die dort entwickelten Instrumente für Öffnungsprozesse im Hinblick auf Querschnitts-themen (Gender oder Interkult) nutzbar zu machen (vgl. Handschuck/Schröer 2000).
Der vornehmlich technokratische Charakter einer Verwaltungsreform nach dem Neu-en Steuerungsmodell hat uns im Stadtjugendamt München sehr früh veranlasst, die-sen Steuerungsansatz fachlich zu unterfüttern und zu erweitern um die bewährten Entwicklungsinstrumente des Kinder- und Jugendhilferechts: Die beteiligungsorien-tierte Kinder- und Jugendplanung, die einen sozial- und jugendpolitischen Diskurs mit Trägern, Politik, Sozialverwaltung und Betroffenen zur Erarbeitung von Zielen erfordert. Und ferner um Qualitätsentwicklung, die den Prozess der Leistungserbringung als wesentliches Element für den Erfolg Sozialer Arbeit in den Blick nimmt und Vor-aussetzungen für kontinuierliche Verbesserungsprozesse schafft. Das alles muss ergänzt werden um Maßnahmen der Personalentwicklung. Das bedeutet einmal, dass Menschen mit Migrationshintergrund als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die öffentliche Verwaltung aktiv geworben werden. Denn nur so spiegelt sich die gesell-schaftliche Realität auch in der Mitarbeiterschaft der Kommunen wider und es werden produktive Auseinandersetzungen in interkulturellen Teams ermöglicht. Zum anderen geht es darum, dass die Institutionen und ihre Mitarbeiterschaft den kompetenten Umgang mit Interkulturalität lernen, dass somit die Kompetenz vermittelt wird, in interkulturellen Überschneidungssituationen angemessen zu reagieren und mit ethni-schen Minderheiten kultursensibel umzugehen.
3.3 Sozialräumliche Ebene
Die sozialräumliche Orientierung kommunalen Handelns geht davon aus, dass die jeweilige soziale Beschaffenheit von Räumen die spezifischen sozialen Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, von Alten und Alleinstehenden, von Einheimischen wie Zugewanderten prägt. Dort also, wo kommunale Angebote ihre Wirkung nur im Zusammenhang des sozialräumlichen Umfeldes der Bürgerinnen und Bürger entfalten können, müssen sich Planung und Dienstleistungen auf dieses kon-krete Lebensfeld einlassen. Das hat eine weitgehend Dezentralisierung und Regio-nalisierung der kommunalen Angebote zur Folge und einen Planungsansatz, der darauf gerichtet ist, die konkreten Lebenslagen im Stadtteil für alle Bewohnerinnen und Bewohner so zu gestalten, zu fördern oder zu verändern, dass sie sich einander weitgehend angleichen. Dabei sind die individuellen Ressourcen, die nachbarschaft-lichen Netze und die sozialen Einbettungen produktiv zu nutzen.
Mit dieser sozialräumlichen Orientierung korrespondiert der Blick auf die Lebensla-gen von Menschen. Nach unserer Definition zielt kommunale Integrationspolitik auf die Angleichung der Lebenslagen von Zugewanderten und Einheimischen. Mit dem Begriff der „Lebenslage“ soll ein gemeinsames Planungsverständnis formuliert werden, das den sozialen Wandel und die veränderte Sozialstruktur in seine Analyse aufnimmt, um so der zunehmenden gesellschaftlichen Differenzierung gerecht zu werden. Es geht bei der Feststellung von sozialer Ungleichheit nicht mehr vorwie-gend um die Analyse der Stellung im Erwerbsleben, sondern in gleicher Weise um neue Dimensionen sozialer Differenzierungen wie Geschlecht, Alter, Bildung, Armut, Migration
oder regionales Lebensumfeld. Damit greift Integrationspolitik bei der Analyse ihrer Ausgangssituation sowohl objektive Lebensbedingungen wie subjektive Einstellungen auf.
Ergänzend zu diesem grundsätzlichen Ansatz ist eine Zielgruppenorientierung dann sinnvoll, wenn Maßnahmen im Sozialraum nicht realisierbar sind (z.B. arbeitsför-dernde Maßnahmen, mädchen- und frauenspezifische Angebote), wenn gezielte kompensatorische Angebote nur stadtweit wirksam werden (z.B. Migrations- und Sprachfördermaßnahmen) oder wenn Angebote für kleine Minderheiten nur überre-gional sinnvoll erscheinen (z.B. ethnische Kulturvereine).
Ein sozialraumorientierter Zugang für interkulturelle Öffnungsprozesse und Integrati-onsmaßnahmen konzentriert sich also auf die Einrichtungen des sozialen Raums und setzt darauf, dass durch gemeinsame Veränderungsprozesse eine konsequente Kundenorientierung im Sinne interkultureller Öffnung erfolgt. Damit wird das Ziel ver-folgt, durch eine strukturorientierte Strategie nachhaltig zu einer interkulturellen Ori-entierung und Öffnung von sozialen und anderen Diensten im Stadtteil beizutragen. Hier haben wir in München in den vergangenen Jahren positive Erfahrungen mit zwei Modellprojekten sammeln können. Zum einen wurden in zwei Münchner Sozialregionen „Sachverständige für Migrationsfragen“ installiert, die den Einrichtungen und Diensten im Stadtteil beratend und unterstützend zur Verfügung standen und die durch eigenständige Initiativen Qualifizierungsprozesse in Gang gesetzt haben. Zum anderen wurde in zwei Sozialregionen eine „interkulturell orientierte Qualitätsentwick-lung“ angeboten, die zu einer nachhaltigen interkulturellen Orientierung und Öffnung der Dienste beitragen sowie zu einer Einstellungs- und Verhaltensänderung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit zu einer qualifizierten Veränderung der Organisationen von innen heraus führen.
4. Kommunale Integrationsstrategien
Im Folgenden sollen kommunale Strategien zur gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten und Beispiele aus München für eine Verbesserung zivil-gesellschaftlicher Chancengleichheit vorgestellt werden. Als orientierende Gliederung dienen die vier Dimensionen gesellschaftlicher Integrationsprozesse, auf die die Hinweise bezogen werden.
4.1 Strukturelle Integration
Selbstkritisch muss für die integrationspolitische Diskussion festgehalten werden, dass in der Vergangenheit sehr stark formal-demokratisch und strukturorientiert geführt worden ist. Die Forderung nach der Einräumung formaler Rechte und die Er-möglichung von Mitgliedschaften in politisch relevanten Institutionen und Gremien stand sehr stark im Vordergrund. Vernachlässigt wurden eher kommunikative Pro-zesse für interkulturellen Austausch und Überlegungen zur Selbstorganisation und Gemeinschaftsfähigkeit von Zugewanderten. Ohne die formal-demokratische Per-spektive aus dem Blick zu verlieren, soll in Zukunft doch stärker auch auf die Ermög-lichung von Kommunikation geachtet werden.
Ihren Abschluss finden strukturelle Integrationsprozesse zweifellos in der Einbürge-rung von Einwanderinnen und Einwanderern. Deren Erleichterung und Informations-kampagnen über die Möglichkeiten der Einbürgerung haben zwar in der Vergangen-heit nur bedingt Erfolge gezeigt, bleiben jedoch weiterhin relevant. Dies gilt in glei-cher Weise für die Forderung nach Einräumung des kommunalen Wahlrechts, die bestehenden verfassungsrechtlichen Hürden sind leider hinreichend bekannt. Aus-länderbeiräte oder Integrationsbeiräte können nur bedingt Ersatz sein. Über deren Zukunftsfähigkeit wird aktuell eine heftige Diskussion geführt, die nicht zuletzt durch die geringe Wahlbeteiligung provoziert wurde. Ein völliger Verzicht scheint derzeit eher nicht sinnvoll, überzeugende Perspektiven sind aber noch nicht erkennbar.
Eine kommunale Integrationspolitik bedarf eines strategischen Managements. Struk-turelle Bestandteile sind beispielsweise (wie in München) eine Stelle für interkulturelle Arbeit oder Integrationsbeauftragte. Ergänzend sollten eine Antidiskriminierungsstelle mit Ombudscharakter vorhanden sein und Voraussetzungen für eine Antiras-sismusarbeit. Solchen Stellen müssen eine Initiativfunktion und Interventionsrechte eingeräumt sein, um wirkungsvoll tätig werden zu können. Derartige Funktionen müssen eingebunden sein in formale Beteiligungsstrukturen. München beispielsweise verfügt über eine Stadtratskommission zur Integrationsförderung, denkbar sind interkulturelle Räte und andere Gremien, in denen Politik, Verwaltung, Fachebene und Betroffene zusammenwirken. Möglich und in einigen Kommunen eingeführt sind interkulturelle oder Integrationsausschüsse als formale Beschlussgremien des Stadt- bzw. Gemeinderates. In München gibt es überdies mit dem „Arbeitskreis Kooperation und Koordination im Ausländerbereich“ eine wirkungsvolle Vernetzung der Fachebene oder mit dem „Runden Tisch der Muslime“ beim 3. Bürgermeister eine Informations- und Kommunikationsdrehscheibe für diesen gesellschaftlichen Diskurs.
Wichtige Indikatoren für die strukturelle Integration von Zugewanderten sind deren formale Beteiligungen in öffentlichen oder politischen Funktionen. So sind im Münchner Stadtrat in drei Ratsfraktionen vier Mitglieder mit Migrationshintergrund gewählt. Dies aktiv zu fördern und damit auf der Ebene des Stadtteils beispielsweise in den Bezirksausschüssen zu beginnen, wäre eine bedeutende integrationspolitische Initia-tive. Aber auch die Mitwirkung in Elternbeiräten in Kindergärten und Schulen sowie die Öffnung der Jugendverbände für junge Menschen mit Migrationshintergrund und auch für deren Organisationen sind wesentliche Elemente struktureller Integration.
Nur hingewiesen werden soll an dieser Stelle auf das entscheidende Feld des Spracherwerbs, der vorschulischen, schulischen und beruflichen Ausbildung für die strukturelle Integration von Zugewanderten.
4.2 Kulturelle Integration
Eine wesentliche Grundlage für positive Austauschprozesse und die Veränderungen von Einstellungen und Verhalten sind die interkulturelle Orientierung und Öffnung der Regelversorgung und die Einstellung von Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund, wie oben schon angesprochen. Darüber hinaus gilt es, eigene Zugangswege zu und für Migrantinnen und Migranten zu finden. Positive Erfahrungen werden mit allen Ansätzen aufsuchende Arbeit gemacht, wenn also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienste ihren Schreibtisch verlassen und ihre jeweiligen Zielgruppen aktiv aufsuchen und persönlich ansprechen. Hier gilt es, insbesondere alltägliche Kommunikationsorte zu nutzen, wie das beispielsweise in der Elternarbeit oder in Projekten wie „Integration macht Schule“ oder „Elterntalk“ geschieht.
In einer Vielzahl unterschiedlicher Projekte werden in München Grundlagen für kulturelle Integration gelegt, beispielsweise durch das Projekt „Acilim-Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien“, das das Erziehungsverhalten von Migranteneltern positiv be-einflussen will. Ähnliches gilt für „Donna Mobile“, das der Gesundheitsförderung dient oder für das Projekt der “Garten der Kulturen“, das in ganz besonderer Weise unkon-ventionelle Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet.
Derartige Projekte bieten eine gute Chance für eine zielorientierte Informationspolitik, die Wissen über das deutsche Versorgungssystem im konkreten Einzelfall vermittelt, Berührungsängste abbaut und Brücken errichtet. Dazu verhelfen auch Sprach-, In-tegrations- und Orientierungskurse, die lebensweltorientiert angelegt sind wie bei-spielsweise „Hippy“ oder „Mama lernt deutsch“.
Ein wichtiges Feld stellt die Herstellung kultureller Öffentlichkeit dar, wie sie in München beispielsweise durch die große Veranstaltung „AnderArt“, die Ausstellungsmög-lichkeiten in der „Galerie Goethe 53“ oder die vielfältigen Angebote der Münchner Volkshochschule darstellen. In gleicher Weise verhelfen Sportprojekte wie „Basketball um Mitternacht“ oder die Initiative „Bunt kickt gut“ zu kulturellen und persönlichen Austauschprozessen.
4.3 Soziale Integration
Hier findet sich ein weites Feld, das noch in besonderer Weise der Bearbeitung be-darf. Interethnische Beziehungen zu ermöglichen und zu fördern, stellt sich als be-sonders differenziert dar. Vereinsförderung im weitesten Sinne als kommunalpolitische Aufgabe richtet sich auch an Migrantinnen und Migranten. Dies geschieht im Kultur- und Sportbereich in vielfacher Weise, eine Anlaufstelle mit Beratungs- und Unterstützungsfunktion hätte eine wichtige Funktion.
Ein bisher noch eher vernachlässigtes Thema dürfte das bürgerschaftliche Engage-ment von Migrantinnen und Migranten und die Förderung der Selbsthilfe und Selbst-organisation sein. Auch hier können wir in München auf erste positive Erfahrungen zurückblicken: Mit dem Selbsthilfezentrum haben wir einen institutionalisierten Ort in der Förderung und Unterstützung. Hier hat in den vergangenen Jahren eine von Stadtjugendamt und Selbsthilfezentrum veranstaltete Fachgesprächsreihe stattge-funden, die Hilfe zur Selbsthilfe in der Migrationsarbeit leisten und die Vernetzung von Selbsthilfegruppen und Regeldiensten im Migrationskontext fördern sollte. Die Perspektive muss sein, dass auch Migrantinnen und Migranten lernen, Verantwor-tung zu übernehmen, sich selbst zu organisieren und für ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung zu stehen. Die Auseinandersetzung mit den Problemen junger Migrantin-nen und Migranten oder auch mit Fragen der Gesundheit sind Themen, die stärker als bisher in Selbstverantwortung wahrgenommen werden könnten. Hier hat kommunale Verwaltung Verantwortung bei der Unterstützung der Selbstorganisation von Jugendlichen und der Herausbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Es gibt durchaus positive Beispiele der Selbstorganisation etwa von Jugendlichen, die inzwischen auch Mitgliedsorganisationen im Kreisjugendring München - Stadt sind.
4.4 Identifikatorische Integration
Ein Zugehörigkeitsgefühl und die Bereitschaft, sich wirklich mit seinem Sozialraum zu identifizieren, kann wohl erst das Ergebnis eines längeren Integrationsprozesses sein. Schon jetzt kann aber insbesondere bei Jugendlichen festgestellt werden, dass sie sich sehr stark mit lokalen Strukturen identifizieren und sich in ihrer Gruppenbildung häufig danach benennen. Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit sind die Ansätze, die zu einem solchen lokalen Bewusstsein beitragen können. Mit der Förderung ge-meinwesenorientierter Ökonomie gerade auch von Zugewanderten, mit Maßnahmen zur Aufwertung des Quartiers oder mit interkulturell orientierten Strategien zur Quali-tätsentwicklung, die die lokalen Dienste konkret für den kultursensiblen Umgang mit ihrer Bevölkerung qualifizieren, werden Grundlagen für wechselseitige Annähe-rungsprozesse gelegt.
Interkulturelles Zusammenleben ist aber nicht konfliktfrei, deshalb sind Ansätze inter-kultureller Mediation im Stadtteil von großer Bedeutung. Wir haben in München mit der Arbeiterwohlfahrt gemeinsam ein Projekt „Konflikt im interkulturellen Kontext“ durchgeführt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür qualifiziert, solche Konflikte beispielhaft anzugehen. Ein Beitrag zur Verhinderung solcher Konflikte ist die Beteili-gung der Migrationsbevölkerung an der Gestaltung ihres Wohnumfeldes und die Ein-beziehung von Mieterinnen und Mietern mit Migrationshintergrund in Mieterbeiräte der Wohnungsbaugesellschaften. Das von der Bundesregierung finanzierte Programm „Soziale Stadt“ bietet gute Ansatzmöglichkeiten, gerade in Stadtteilen mit hoher Migrationsbevölkerung infrastrukturelle und soziale Maßnahmen für eine Aufwertung benachteiligter Stadtteile zu finanzieren.
5. Resümee
Die formale Partizipation für Zuwanderinnen und Zuwanderer ist wichtig und anzu-streben. Wahlrechte sind für deren Repräsentation und Interessenartikulation bzw. deren Berücksichtigung unabdingbar.
Befähigungsprozesse und Beteiligungsmöglichkeiten als Basis interkultureller Ver-ständigungsprozesse und entsprechender Kommunikationsmöglichkeiten sind in gleicher Weise wichtig und fördern.
Das verlangt nach einem interkulturellen und integrationspolitischen Konzept der Kommunen mit den Eckpfeilern
• interkulturell sensible und partizipative Stadtentwicklungsplanung,
• interkulturelle Orientierung und Öffnung der Kommunalverwaltung und ihrer Maß-nahmen und Angebote
• sozialräumliche Orientierung der Maßnahmen und interkulturelle Qualifizierung der Anbieter.
Für Querschnittsaufgaben muss ein „Mainstreamingansatz“ gefunden werden. Der Umgang mit Unterschiedlichkeit und Vielfalt wird zu einem beherrschenden Quer-schnittsthema. Damit umgehen zu können, wird zur unabdingbaren Schlüsselqualifi-kation für kommunale Verwaltungen.
Die Diskussion um interkulturelle Orientierung sollte deshalb verbunden werden mit vergleichbaren Ansätzen: Sowohl das Prinzip des Gender Mainstreaming wie Pro-zesse von Managing Diversity haben ganz ähnliche Ausgangspunkte. Sie zielen auf eine Reorganisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entschei-dungsprozessen in allen Politik- und Arbeitsbereichen einer Organisation. Bei allen diesen Strategien ist die Idee der Querschnittspolitik grundlegend, da Chancen-gleichheit sich nur herstellen lässt, wenn sie in allen Bereichen angestrebt wird. Die Verbindung dieser Ansätze zur „Gestaltung von Vielfalt“ bietet sich auch an, um Syn-ergieeffekte zu erzielen und Kräfte zu bündeln.
Es geht also um die Anerkennung von Gleichwertigkeit und die Anerkennung von Verschiedenheit und damit auch um einen Beitrag zum Erreichen von Chancen-gleichheit und sozialer Gerechtigkeit.
Literatur:
Hamburger, F. (1999). Von der Gastarbeiterbetreuung zur Reflexiven Interkulturalität. In: Migration und soziale Arbeit 3 – 4, S. 33 – 39
Handschuck, S./Schröer H. (2000). Interkulturelle Öffnung sozialer Dienste. Ein Stra-tegievorschlag. In: Migration und soziale Arbeit 3 – 4, S. 86 – 95.
Heckmann, F. (2003). Bedingungen erfolgreicher Integration. Eröffnungsvortrag zur Tagung der Ausländer-/Integrationsbeauftragten des Bundes, der Länder und der Kommunen, Augsburg.
Dr. Hubertus Schröer
|